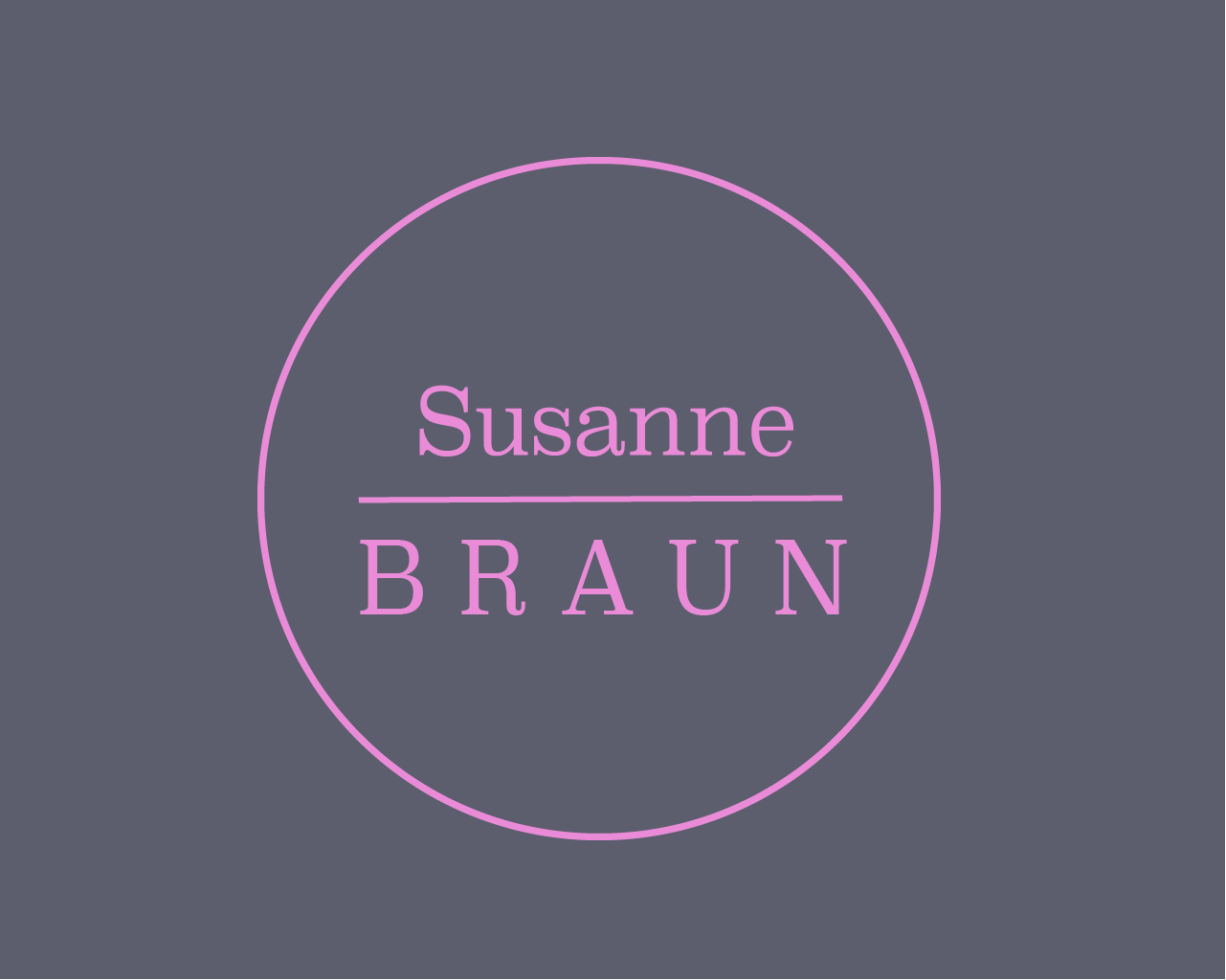Schlagwort: ausflugstipp
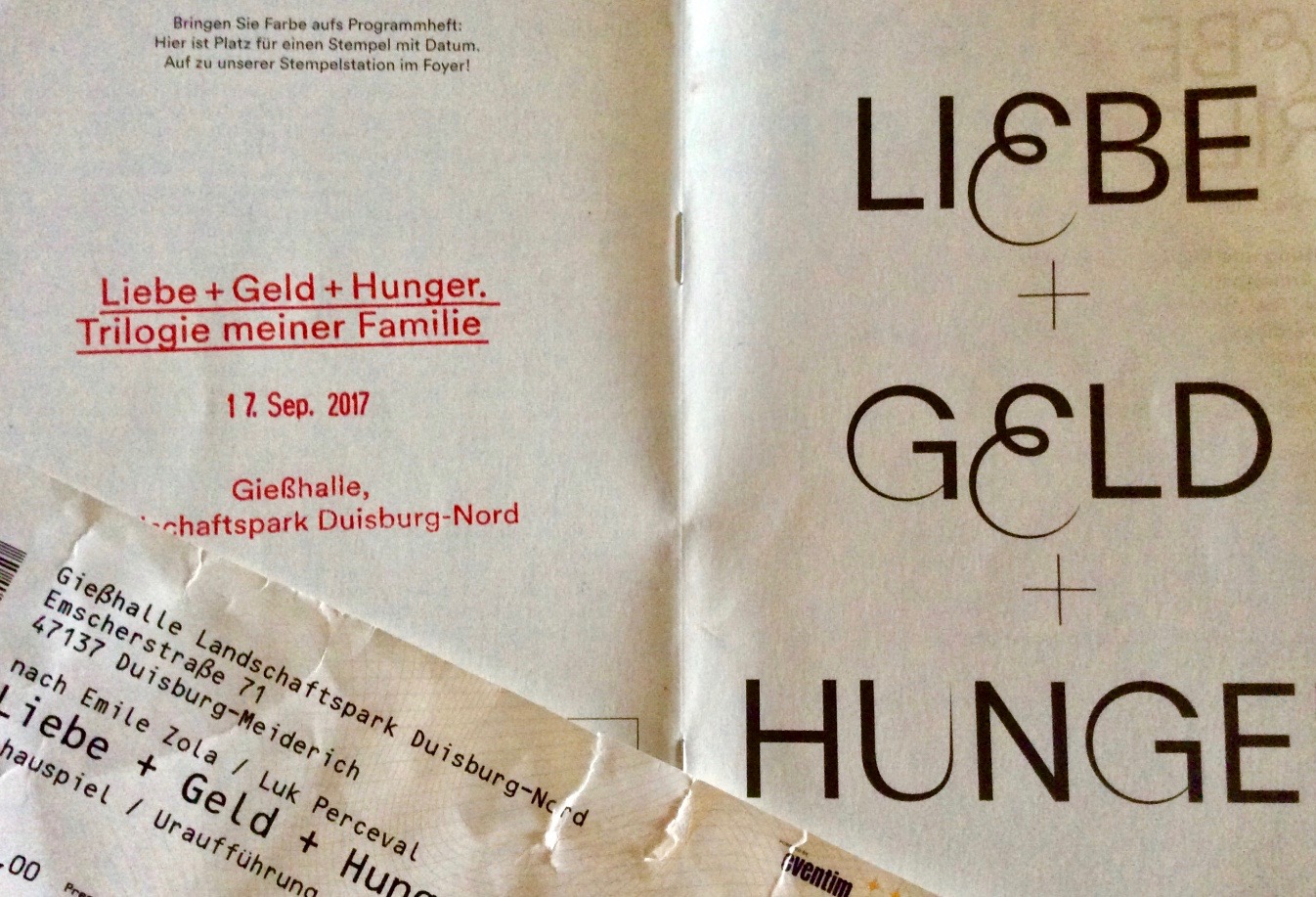
Trilogie meiner Familie
Gervaise hat Glück. In Trilogie meiner Familie hat sie endlich einen freundlichen und meistens sogar lustigen Mann gefunden, der sie trotz ihrer Kinder heiratet und sogar seinen Lohn nach Hause bringt, statt ihn zu vertrinken. Die Erleichterung ist in der ganzen Familie groß. Während dessen setzt sich Doktor Pascal über die Mahnungen seiner streng gläubigen…

Über das Leben in Städten
Ein Schwerpunkt der letzten Ausgabe des internationalen literaturfestival berlin war die Reihe ‚Visions 2030’, die sich mit dem Leben in Städten auf allen fünf Kontinenten, heute und in Zukunft, beschäftigt hat. Omar Akbar war Diskussionsleiter der Reihe und beschreibt, warum dieses Thema so wichtig ist: Omar Akbar: „In der Stadt sammeln sich Ethnien, Kulturen, Innovationen, Forschung…

Real Magic
In dem Stück Real Magic von der Experimentaltheatergruppe Forced Entertainment ist es ein bisschen wie im Zirkus oder in einer Fernseh-Quiz-Show zur besten Sendezeit: Ein Kandidat hat die Aufgabe, ‚nur’ ein einziges Wort zu erraten. Nicht irgendein Wort, sondern genau das Wort, das ein anderer sich gedanklich vorstellt und auf einem Pappschild geschrieben vor sich hochhält. Natürlich…

The Dog’s Notes
Sie sind überwiegend aus schwarz-glänzendem Material, die Hundeskulpturen des auf der Insel Taiwan lebenden und arbeitenden Künstlers Poren Huang. Damit bilden die in The Dog’s Notes ausgestellten Hunde ihr Vorbild in entscheidender Hinsicht realitätsgetreu nach: den Taiwanhund, der besonders oft über ein schwarzes Fell verfügt. In Taiwan ist der Hund seit Jahrhunderten ein treuer Begleiter…
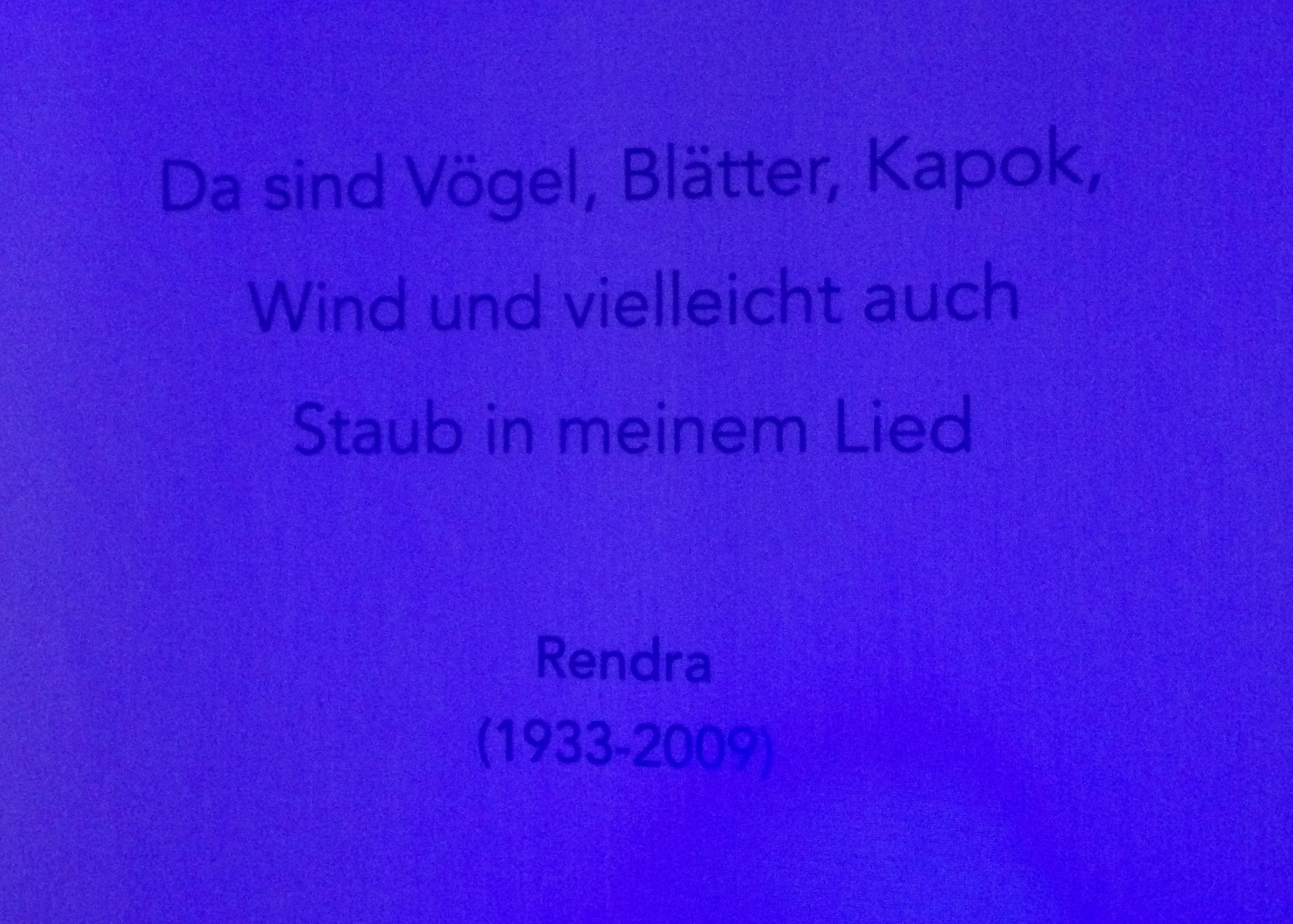
Indonesische Lyrik
Viele Besucher sind ins Literaturhaus Berlin gekommen, um indonesische Lyrik kennen zu lernen. Meist wird der Text erst in der offiziellen indonesischen Landessprache Bahasa Indonesia gelesen, dann auf Deutsch. Die Eindrücke könnten unterschiedlicher kaum sein: Auf der einen Seite die sehr melodisch klingenden Worte, denen der vortragende Agus R. Sarjono mit viel Emphase Leben einhaucht und auf der…

Maori-Nacht
Er ist unauffällig mit dunklem Hemd und dunkler Hose bekleidet, hält eine Gitarre in der Hand und spricht Englisch. Von Weitem hat er vielleicht am ehesten Ähnlichkeit mit einem Country-Sänger. Doch der Klang seiner Gitarre, die Geschichte und die Art seines Vortrags bei der Maori-Nacht haben allenfalls entfernt etwas von dem, was den wilden Westen…

Life and Times, Episode 2
Bei Life and Times – Episode 2 von Nature Theater of Oklahoma gibt es kein Bühnenbild und fast überhaupt keine Requisiten. Den größten Teil des Stückes über sind nur die Hauptdarsteller in ihren grellbunten Jogginganzügen vor schwarzem Hintergrund zu sehen, eingerahmt von zwei Flatscreens am rechten und linken Ende der Bühne. Auf den Screens ist der englische…

12 Rooms
Als ich den Bereich der Ausstellung 12 Rooms im Museum Folkwang in Essen betrete, wirkt auf mich alles sehr unspektakulär. Ich sehe nur graue Wände, in die manchmal eine Tür eingelassen ist. Die Türen sind verschlossen und es sind auch keine Geräusche zu hören. Langsam bemerke ich, dass ich mich in einem labyrinthartigen Gangsystem aus grauen Wänden und verschlossenen Türen…